20 Jahre schweizerisches Energiegesetz – Teil 5
Vor 20 Jahren, am 1. Januar 1999, ist das erste Schweizer Energiegesetz in Kraft getreten. Seine Entstehungsgeschichte ist einzigartig. Grund genug, in einer fünfteiligen Blogserie auf ein spannendes Stück Schweizer Politikgeschichte zurückzublicken. Im fünften und letzten Teil unserer Serie geht es um die Erarbeitung des Energiegesetzes, die 1990 nach der der erfolgreichen Abstimmung zum Energieartikel in Angriff genommen wurde.
Teil 5: Das Energiegesetz kann kein innovatives Gesetz sein
Mit der Erarbeitung des Energiegesetzes wurde unmittelbar nach der am 23. September 1990 gewonnenen Abstimmung zum Energieartikel begonnen. Die Meinungsführer brachten sich frühzeitig in Stellung. So liess sich Alex Niederberger, der damalige Präsident des Verbands der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen VSE im August 1993 vernehmen, dass das neue Energiegesetz «Abschied zu nehmen habe vom Geist des Energienutzungsbeschlusses» und die Kundenbedürfnisse den Marktkräften und nicht der Bürokratie zu überlassen seien.
Der Plan: Ein energie- und umweltpolitisches Gesamtpaket
1994 erfolgte die Vernehmlassung zum Vorentwurf des Energiegesetzes. Er umfasste 36 Artikel. Bundesrat Adolf Ogi erklärte zum Start der Vernehmlassung, dass das Gesetz den Energienutzungsbeschluss ablösen und ergänzen solle und zusammen mit der geplanten CO2-Lenkungsabgabe, die einen Monat zuvor in die Vernehmlassung geschickt wurde, ein energie- und umweltpolitisches Gesamtpaket bilde. Falls eine CO2-Abgabe eingeführt werde, hätte dies auch Auswirkungen das Energiegesetz. Denn wenn die Lenkungsabgabe die gewünschte Wirkung entfalte, könnte der Bundesrat einige Bestimmungen des Energiegesetzes wieder aufheben.
Heftige Kritik aus der Wirtschaft
Dass der Vorentwurf des Energiegesetzes nicht auf uneingeschränkte Zustimmung treffen würde, war klar. Insbesondere die Wirtschaft zeigte sich sehr kritisch. So berichtete die NZZ vom 29. September 1994 über ein Referat von Gustav E. Grisard, Vizepräsident des Vororts: «(Er) legte in seinen Ausführungen dar, dass die breit abgestützte Umfrage innerhalb des Verbandes eine selten heftige Ablehnung des Entwurfs zum neuen Energiegesetz zutage gebracht hatte Der Referent bemängelte, dass als Ausgangspunkt des Entwurfes nicht der Energieartikel, sondern der Energienutzungsbeschluss gewählt worden ist. Diese Vorgehensweise sei rechtlich unzulässig und werde durch die Tatsache verschlimmert, dass der interventionistische Charakter des Energienutzungsbeschlusses nun durch zahlreiche überflüssige Regulierungen erweitert wird. So stösst etwa die vorgesehene Verpflichtung der Elektrizitäts- und Gaswerke, angebots- und nachfrageseitige Massnahmen für eine effiziente Energieerzeugung treffen zu müssen (Integrierte Ressourcenplanung) beim Vorort ebenso wenig auf Verständnis wie die geplanten Entscheidungsbefugnisse des Bundesrates, für serienmässig hergestellte Anlagen, Fahrzeuge und Geräte ohne Zustimmung des Parlamentes Zulassungsanforderungen einzuführen. Abgelehnt werden auch die vorgeschlagenen Subventionen zur Förderung erneuerbarer Energien und die Verkoppelung des Energiegesetzes mit der CO2-Vorlage.»
Zurück auf Feld 1
Das ernüchternde Ergebnis der Vernehmlassung veranlasste den Bundesrat, eine starke Straffung und Überarbeitung des Entwurfs anzuordnen. In der NZZ vom 1. Juni 1995 erklärte Bundesrat Ogi, «dass die Vernehmlassung äusserst kontrovers ausgefallen sei. Die Kantone wünschten ein Rahmengesetz, die Wirtschaft vermisse Rahmenbedingungen zur Energieversorgung, die Grünen und die Umweltschutzorganisationen ein noch griffigeres Gesetz. Die Schaffung eines Energiegesetzes komme deshalb der Quadratur des Kreises gleich.» Weiter beschloss der Bundesrat, statt eines reinen CO2-Abgabegesetzes ein umfassendes Bundesgesetz zur Reduktion der CO2-Emissionen auszuarbeiten. Die Botschaft zum Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen legte der Bundesrat im März 1997 vor, das CO2-Gesetz trat im Jahr 2000 in Kraft.
Mehr als ein Jahr nach Abschluss der Vernehmlassung verabschiedete der Bundesrat im August 1996 die Botschaft zum Energiegesetz. Das vorgelegte Energiegesetz war äusserst schlank und enthielt nur gerade 32 Artikel. Die Sendung 10 vor 10 vom 21. August 1996 berichtete darüber.
Eigentlich der dritte Entwurf
In der Debatte im Sommer 1997 ging Bundesrat Moritz Leuenberger, der 1995 als fünfter Bundesrat die Verantwortung über die Energiepolitik der Schweiz übernommen hatte, auf die sehr harzige Erarbeitung des Gesetzes ein: «Die Entstehungsgeschichte dieses Energiegesetzes mag Ihnen auch die Kritik von beiden Seiten erklären. 1994 wurde das Vernehmlassungsverfahren – übrigens gleichzeitig mit demjenigen bezüglich einer CO2-Abgabe – gestartet. Das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens war dermassen kontrovers, dass der Entwurf nochmals überarbeitet wurde und anschliessend sehr viele Gespräche mit den interessierten Organisationen, aber auch mit den Kantonen, mit Gewerkschaften und Umweltschutzkreisen stattfanden. Das so entstandene zweite, abgeänderte Gesetz fand aber wiederum dermassen kontroverse Echos, dass eine zweite Überarbeitung erfolgte. Noch einmal mussten die interessierten Kreise angehört werden, so dass wir heute eigentlich mit dem dritten Entwurf arbeiten.»
Energiegesetz eigentlich nur noch ein Nebenschauplatz
Die NZZ vom 30. Mai 1997 kommentierte die schwierige Situation der Gesetzesvorlage: «Auch wenn die energiepolitischen Frontstellungen in diesen Bereichen seit den späten achtziger Jahren sich nicht stark verändert haben, so haben sich doch andere Problemfelder in den Vordergrund geschoben. Die Energiediskussion ist endgültig eine globale, zumindest europäische geworden, sie steht auch in der Schweiz zunehmend im Zeichen von Liberalisierung und Marktöffnung. Viele Unternehmen der Energieversorgung sind übernational geworden, was vor allem bei den leitungsgebundenen Energien (Strom und Gas) neue Entwicklungen sind. Die Marktöffnung, die von manchen Kreisen angestrebte Entpolitisierung der Energieversorgungsunternehmen und konkret der Zutritt von Dritten zu den bestehenden Versorgungsnetzen dürften in den kommenden Jahren noch weitere Bewegung in die Energieszene bringen. Über all dies sagt das Energiegesetz nichts … So ist es – angesichts der zu erwartenden harten Diskussionen über die grossen aktuellen Themen in der Energiepolitik – fast zum Nebenschauplatz geworden.»
Das Energiegesetz kann kein innovatives Gesetz sein
Nationalrat und Berichterstatter Toni Dettling hielt im Nationalrat (Amtliches Bulletin) denn auch fest: «Am 23. September 1990, also vor sieben Jahren, haben Volk und Stände mit klarer Mehrheit … Artikel 24octies der Bundesverfassung angenommen und damit die Weichen für unsere künftige Energiepolitik gestellt. In der Zwischenzeit haben sich allerdings die Bedingungen sowohl im nationalen wie auch im internationalen Bereich wesentlich verändert. … So gesehen bleibt auch der heutige Gesetzentwurf nur ein Stückwerk, der aufgrund der künftigen Entwicklung und der bereits angekündigten Gesetzesvorhaben wohl auch in nicht allzuferner Zukunft wieder zu hinterfragen sein wird.» Und auch Ständerat Gian-Reto Plattner, Berichterstatter der ständerätlichen Kommission, schlug in die gleiche Kerbe: «Das macht klar, dass das Energiegesetz kein innovatives Gesetz sein kann. Der Bundesrat hatte diesen Anspruch eigentlich auch nicht. Es ging ihm darum, einen dauerhaften Rahmen für seine gemässigt fortschrittliche Politik zu schaffen, die sich z.B. im Rahmen des Aktionsprogrammes Energie 2000 äussert…… Wenn Sie sich überlegen, welche zentralen Fragen der Energiepolitik in den nächsten Jahren anstehen, dann sehen Sie sofort, dass das Energiegesetz nicht das letzte Gesetz in diesem Bereich sein kann.»
Schlank oder mager?
Franziska Teuscher sah die Sache etwas anders: «Das Energiegesetz wurde uns als schlankes Rahmengesetz angepriesen. Als es sich in der Öffentlichkeit präsentierte, musste die grüne Fraktion allerdings feststellen: Der Gesetzentwurf ist nicht schlank, sondern mager, ja sogar zu mager. Problematisch am Entwurf des Bundesrates ist nicht so sehr, was drin steht, sondern was nicht darin steht.»
Forderung nach Marktöffnung
Die Mehrheiten im Parlament waren aber mit dem mageren Gesetz zufrieden, nur wenige Änderungen wurden eingebracht. In der Debatte wurde jedoch Richtung Bundesrat immer wieder die Forderung nach einer Marktöffnung eingebracht und damit wieder die bekannte Argumentation, dass der Markt die Herausforderungen im Energiebereich am besten alleine bewältigen könne.
So liess beispielsweise Nationalrat Peter Baumberger verlauten: «Ein wesentlicher Diskussionspunkt wird noch die Frage der Marktöffnung sein. … im Sinne des Subsidiaritätsprinzips soll auch der Wirtschaft – insbesondere der Elektrowirtschaft und der Gaswirtschaft – Gelegenheit gegeben werden, selbst zum rechten zu sehen, denn vieles, was unter dem Titel Marktöffnung notwendig ist, kann die Wirtschaft selbst machen.»
Auch Nationalrat Georg Stucky kritisierte das Energiegesetz, das die Frage der Marktöffnung nicht adressierte: «Bei diesem Energiegesetz fällt man zurück in eine Art von Freiwilligkeit und gleichzeitig von Zwang – mit Staatsbefehlen und Appellen –, kurz: in einen Prozess, der im grossen und ganzen wieder mehr staatliche Eingriffe bringt. … Ich hätte eigentlich eher erwartet, dass der Bundesrat endlich einmal dort eingreift, wo immer noch Monopole bestehen. Wir haben die deutlichsten Gebietsmonopole heute im Angebotsmarkt für Elektrizität und Gas. …Wir sollten jetzt einmal den Mut haben, das zu ändern. Ich gestatte mir die Frage an Herrn Bundesrat Leuenberger, wann wir endlich die Vorlage über die Liberalisierung des Elektrizitäts- und Gasmarktes erwarten dürfen. Ich hätte es vorgezogen, wenn man beide Dinge parallel hätte behandeln können.»
Bundesrat Leuenberger rechtfertigte das Fehlen von Elementen für die Marktöffnung im Energiegesetz damit, dass die politischen Grundlagen bei der Ausarbeitung des Energiegesetzes noch nicht vorhanden waren: «Wir mussten darauf Rücksicht nehmen, in welcher Art und Weise die EU diese Marktöffnung und Stromliberalisierung angeht. Die entsprechende Richtlinie datiert vom 19. Dezember 1996, und sie wird auf das Jahr 1999 in Kraft treten. Wir haben jetzt diese Grundlagen und sind daran, ein Marktöffnungsgesetz vorzubereiten.»
Im Februar 1998 startete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Elektrizitätsmarktgesetz EMG (siehe Bild) und legte die Botschaft schliesslich im Juni 1999 vor. Im Dezember 2000 wurde das EMG vom Parlament verabschiedet, scheiterte aber in der Referendumsabstimmung vom 22. September 2002 mit 52.6% Nein-Stimmen (Abstimmungsbüchlein). Auch hier brauchte es einen zweiten Anlauf: Die vom Bund eingesetzte Expertenkommission ELWO (Elektriziätswirtschaftsordnung) erarbeitet einen neuen Gesetzesentwurf. Das Stromversorgungsgesetz wurde 2007 vom Parlament verabschiedet und trat 2008/09 in Kraft.
Rückschritt hinter den Energienutzungsbeschluss
Im Energienutzungsbeschluss (siehe Teil 4 der Blogserie) waren die verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung bei bestehenden Gebäuden und die Bewilligungspflicht für neue ortsfeste Elektroheizungen festgeschrieben. Entgegen dem Vorschlag des Bundesrats strich das Parlament beide Vorschriften aus dem Energiegesetz.
Ausbau für Winterspitze: Das teuerste und unrentabelste Energieversorgungssystem
Nationalrat Rudolf Strahm wehrte sich vergebens gegen die Streichung: «Es geht darum, dass Absatz 4, wie ihn der Bundesrat vorgeschlagen hat, beibehalten wird; die Kantone sollen die Installation neuer ortsfester Elektroheizungen einer Bewilligungspflicht unterstellen können. … Bisher ist diese Regelung auch im Energienutzungsbeschluss enthalten. Viele Kantone haben davon Gebrauch gemacht, einige Kantone nicht. … Elektroheizungen blähen die Stromproduktionsanlagen für den Winterbedarf auf. Nach neueren Studien – das war bei der ersten Lesung in der Kommission noch nicht bekannt – machen die Elektroheizungen immerhin 20 Prozent des Stromverbrauchs im Winterhalbjahr aus, ganzjährig sind es 11 Prozent. … Die Produktionsanlagen müssen für die Winterspitze ausgebaut werden, und das erhöht natürlich die Verbrauchsdifferenz zwischen Winterspitze und «Sommertal». Wir wissen, dass die teuersten Investitionen bei der Energieproduktion dann anfallen, wenn die Kapazitätsauslastung nur für eine kurze Periode möglich ist. Die Kapazitätsauslastung wird auf die Spitzenverbrauchszeit im Winter zugeschnitten, und es gibt dann wieder Überkapazitäten im Sommer, in der Niedrigkonsumperiode. Das ist eigentlich das teuerste, volkswirtschaftlich auch das unrentabelste Energieversorgungssystem. … Wenn man in Produktionskapazitäten investieren muss, die nur für den Winter dienen, weil diese Elektrospeicherheizungen im Winter die grossen «Stromfresser» sind, dann ist das volkswirtschaftlich fehl am Platz.»
Nationalrat Christian Speck hingegen ortete in der bisherigen Bewilligungspflicht laut Energienutzungsbeschluss eine klare Diskriminierung der Elektrizität. Diese Vorschrift sei angesichts der bevorstehenden Marktöffnung nicht mehr zeitgemäss. Diese Meinung setzte sich schliesslich durch.
Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung: Ein Überbleibsel
Nicht besser erging es der verbrauchsabhängigen Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung VHKA. Nationalrat Rolf Hegetschweiler bezeichnete sie als ein Überbleibsel, das in der heutigen Zeit nicht mehr nötig sei: «Ursache des hohen Energieverbrauchs in Altbauten ist nämlich nicht das übermässige Heizen, sondern vielmehr die Bauweise älterer Gebäude, deren Wärmedämmung oft ungenügend ist, sowie überdimensionierte alte Heizungen. Anstatt dieses Problem mittels baulicher Massnahmen am Gebäude zu beheben, will die VHKA diese Mängel messen und dann irgendwie gerecht auf alle Hausbewohner verteilen….. Lassen wir doch auch hier die Marktkräfte spielen, und streichen wir die Bewilligungspflicht!»
Anschlussbedingungen für unabhängige Produzenten
Zu reden gaben auch die Anschlussbedingungen für unabhängige Energieproduzenten. Hierzu machte sich Nationalrat Hanspeter Thür vergeblich für eine privilegierte Entschädigung für Produzenten von Solarstrom stark: «Mit unserem Antrag zu Artikel 7 Absatz 3 möchten wir eine Sonderbehandlung der Erzeuger von Solarenergie gegenüber den übrigen Produzenten von erneuerbaren Energien… (Dieser Artikel) sieht lediglich eine Abnahmeverpflichtung für Strom vor, der aus erneuerbarer Energie gewonnen wird, und garantiert einen Preis zu den Kosten für die Beschaffung gleichwertiger Energie aus zuletzt realisierten inländischen Produktionsanlagen. Das sind heute durchschnittlich 16 Rappen pro Kilowattstunde. Eine solche Entschädigung ist für die Wasserkraft, die Holzverbrennung oder andere Technologien ausreichend, nicht aber für die Solarstromerzeugung. Aus verschiedenen Gründen – vor allem weil die Solartechnologie immer noch mit sehr kleinen Serien arbeiten muss – kostet hier eine Kilowattstunde immer noch rund einen Franken. … Wir beantragen, dass bei der Solartechnologie ein Preis vergütet wird, der bei Anwendung der neuesten Technik kostendeckend ist. Ein solches Rückvergütungssystem fördert die technologische Entwicklung ungemein, weil immer nur die neueste Anlage gefördert wird.»
Fossile Stromproduktion
Bei der Diskussion zu Artikel 6 über die fossile Stromproduktion hielt Nationalrat Rudolf Rechsteiner ein Plädoyer für die Wärmekraftkopplung (WKK): «Wir glauben, dass die Wärme-Kraft-Koppelung in Zukunft eine Rolle in unserem Land spielen wird. Wir stellen auch fest, dass das Gas im Vergleich zum Öl eine bessere CO2-Bilanz hat. Aber es geht auch darum, die einheimische Wasserkraft nicht zu vernachlässigen, denn sie ist – ökologisch gesehen – weit überlegen. … Denken Sie daran: Es war früher so, dass immer grössere Kraftwerke immer effizienter waren, sowohl preislich als auch ökologisch. Heute ist es nicht mehr so. Wir sind heute technologisch in der Lage, Gaskraftwerke mit einer Leistung von einigen hundert Kilowatt dezentral in Quartieren oder selbst in Gemeindezentren aufzustellen, die Strom produzieren. Diese sind ökonomisch und ökologisch absolut gleichwertig mit den grossen zentralen Anlagen «auf der grünen Wiese», die die Abwärme nicht nutzen. Wir meinen: Hier kann wirklich CO2 gespart werden. Hier kann effizient etwas verbessert werden, ohne dass grosse Kosten zu befürchten sind.» Sein Minderheitsantrag, Artikel 6b mit dem Zusatz «Angestrebt wird ein Wirkungsgrad von mindestens 75 Prozent für jede Anlage» zu ergänzen, und so die WKK gegenüber grossen Gaskraftwerken zu bevorzugen, wurde jedoch abgelehnt.
Energieabgaben und Energiesteuern
Im Sommer 1997 nahm der Nationalrat bei der Beratung des Energiegesetzes den Antrag der Nationalräte Suter/David ins Gesetz auf. Dieser wollte eine Abgabe von 0,6 Rp./kWh auf nicht erneuerbare Energieträger einführen. Mit den Einnahmen von jährlich rund einer Milliarde Franken sollten die Sonnenenergienutzung sowie energiesparende Gebäudeerneuerungen gefördert werden. Im Ständerat kam dieser energiepolitische «Schnellschuss» jedoch nicht gut an, er wollte selbst ein mögliches Abgabesystem entwerfen. Das Parlament beschloss schliesslich, diesen sogenannten Energieabgabebeschluss (EAB) vom Energiegesetz abzutrennen und das Energiegesetz ohne Abgabe zu verabschieden. Im Juni 1998 verabschiedete das Parlament das erste Energiegesetz der Schweiz in der Schlussabstimmung (Energiegesetz: Text der Schlussabstimmung). Das Referendum wurde nicht ergriffe, so dass es am 1. Januar 1999, also vor 20 Jahren, in Kraft treten konnte. Auf den gleichen Zeitpunkt wurde der bis Ende 1998 befristete Energienutzungsbeschluss aufgehoben.
Energieabgaben: Nicht ob, sondern wie!
In der NZZ vom 11. Januar 1999 fasste Ständerat Gian-Reto Plattner die Situation zusammen: «Beide Räte haben das Energiegesetz ohne Abgabe verabschiedet, aber ihre jeweiligen Abgabenprojekte konkretisiert und in eine gemeinsame Vernehmlassung gegeben. … Zwischen den im Nationalrat stark vertretenen Befürworterinnen und Befürwortern der raschen Einführung einer solchen «Förderabgabe» und dem in dieser Sache – im Umfeld der «Energie-Umwelt-» und der Solar-Initiativen – grundsätzlicher argumentierenden Ständerat hat sich allerdings eine fruchtbare Diskussion entwickelt, wie – nicht etwa ob! – Energieabgaben einzuführen seien. … Doch jetzt zeichnet sich eine Lösung ab, die in beiden Räten mehrheitsfähig sein dürfte, da sie die wesentlichen Anliegen beider Kammern aufgreift.» Wie kam es zu dieser Situation?
Energie-Umwelt-Initiative und Solar-Initiative machen Druck
Neben dem 1997 vom Nationalrat lancierten Energieabgabebeschlusses machten auch zwei im Jahr 1995 eingereichte Volksinitiativen Druck. Die Energie-Umwelt-Initiative hatte die Reduktion des Energieverbrauchs zum Ziel und wollte eine Lenkungsabgabe auf den nicht erneuerbaren Energien und auf Elektrizität aus grösseren Wasserkraftwerken einführen. Die Solar-Initiative wollte eine zweckgebundene Abgabe von 0,5 Rappen pro Kilowattstunde auf den nicht erneuerbaren Energien erheben, deren Erträge hälftig zur Förderung der Solarenergie und der rationellen Energienutzung eingesetzt werden sollte.
Bundesrat und Parlament (Verhandlungsheft) lehnten beide Initiativen ab. Im Gegensatz zum Bundesrat war das Parlament jedoch bereit, Gegenentwürfe in Form von Ergänzungen zum Energieartikel in der Bundesverfassung zu erarbeiten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass insbesondere die Gebirgskantone eine ausreichende Förderabgabe für die Wasserkraft als Eintrittspreis für eine zügige Strommarktliberalisierung gefordert hatten.
Energielenkungsabgabe und Förderabgabe als Gegenvorschläge
Als direkten Gegenvorschlag zur Energie-Umwelt-Initiative wurde eine Erweiterung des Energieartikels in der Bundesverfassung vorgeschlagen, der eine Energielenkungsabgabe (Grundnorm) auf nicht-erneuerbaren Energieträgern von höchstens 2 Rappen pro Kilowattstunde vorsah. Mit den Erträgen von jährlich etwa drei Milliarden Franken sollten die Lohn-Nebenkosten um rund ein Lohnprozent gesenkt werden.
Der zweite Gegenvorschlag sah eine auf maximal 15 Jahre befristete Übergangsbestimmung der Bundesverfassung vor, die während dieser Zeit eine zweckgebundene Förderabgabe auf nicht erneuerbaren Energieträgern von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde ermöglichen würde. Die Einnahmen von jährlich rund 450 Millionen Franken sollten für die Förderung der erneuerbaren Energien, die rationelle Energienutzung und die Erhaltung und Erneuerung einheimischer Wasserkraftwerke eingesetzt werden.
Zu komplizierte Abstimmung – Energiewende bleibt ein Phantom
Aufgrund des Gegenvorschlags wurde die Energie-Umwelt-Initiative zurückgezogen, die Solar-Initiative jedoch nicht. Dies schaffte eine komplexe Situation für die Abstimmung und erstmals musste auf Bundesebene eine Stichfrage gestellt werden.
In der Volksabstimmung vom 24. September 2000 (Abstimmungsbüchlein) wurde die Solar-Initiative mit 67,0% Nein-Stimmen und von allen Ständen abgelehnt. Abgelehnt wurde ebenfalls die Förderabgabe mit 51,8%, sowie die Energielenkungsabgabe (Grundnorm) mit 55.5%. Die NZZ vom 25. September 2000 kommentierte das Abstimmungsergebnis mit der Feststellung «Die Energiewende bleibt ein Phantom».
Die Vox-Analyse zur Abstimmung (NZZ vom 11. November 2000) zeigte, dass die drei Energievorlagen von den Stimmbürgern mehrheitlich en bloc abgelehnt oder angenommen wurden, differenziert wurde zwischen den einzelnen Vorlagen selten. Die Vorlage war den meisten Stimmbürgern zu kompliziert. Die Analyse schlussfolgerte, dass die Abstimmungskampagne der Gegner ihre Wirkung nicht verfehlt hatte und auch die Sorge über die in Monaten vor der Abstimmung stark gestiegenen Benzin- und Heizölpreise ebenfalls zur Ablehnung beigetragen hatten.
In der Folge wurde in der Abstimmung vom 2. Dezember 2001 auch die Volksinitiative „Für eine gesicherte AHV – Energie statt Arbeit besteuern“ (Abstimmungsbüchlein) mit 77.1% Nein-Stimmen massiv verworfen.
Fazit
Mit dem Inkrafttreten des Energiegesetzes am 1. Januar 1999 fand ein fast drei Jahrzehnte dauernder energiepolitischer Prozess ein vorläufiges Ende. Die Schweiz hatte nun ein, wenn auch schlankes und wenig innovatives Energiegesetz, doch es spurte die weiteren energiepolitischen Entscheide der Nullerjahre des neuen Jahrtausends vor. Die Schweizer Stimmbevölkerung schien nach dem intensiven Energiediskurs der Vorjahre vom Thema genug zu haben: Nach den 2000 und 2001 gescheiterten Vorlagen für Energiesteuern sowie Energie- und Förderabgaben, wollte sie 2002 auch von der Strommarktöffnung nichts wissen und schickte 2003 zudem eine weitere Atomausstiegsinitiative und eine Initiative zur Verlängerung des 1990 beschlossenen 10-jährigen Moratoriums für den Bau neuer Atomkraftwerke bachab. Danach blieben die Schweizer Bürgerinnen und Bürger auf nationaler Ebene von weiteren Energie-Volksinitiativen unbehelligt und mussten erst wieder 2015 über eine Energievorlage entscheiden (Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer», 92.0% Nein-Stimmen). 2016 lehnten sie eine weitere Atomausstiegsinitiative mit 54.2% Nein-Stimmen ab und 2017 stimmten sie dem neuen Energiegesetz mit 58.2% Ja-Stimmen zu.
Die Energiepolitik blieb derweil nicht untätig. 2004 legte der Bundesrat die Botschaft zum Stromversorgungsgesetz vor, die vom Parlament mit einer Revision des Energiegesetzes zur Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern ergänzt wurde. Mit dem beschlossenen Netzzuschlag von maximal 0,6 Rappen auf jede verbrauchte Kilowattstunde gab es nun erstmals eine finanzielle Grundlage zum Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion in der Schweiz. Gegen das Stromversorgungsgesetz wurde kein Referendum ergriffen und es trat 2008/09 in Kraft.
19 Jahre alt wurde das erste Energiegesetz, bis es 2018 von einer totalrevidierten Version abgelöst wurde. Auslöser dafür war die durch ein Erdbeben verursachte Flutwelle in Japan und der darauffolgende Reaktorunfall in Fukushima vom 11. März 2011. Bundesrätin Doris Leuthard, welche als sechste Bundesrätin seit der Ölkrise für die Weiterentwicklung der schweizerischen Energiepolitik zuständig war, gleiste den Weg in die Zukunft mit der langfristigen Energiestrategie 2050 auf. Ein Puzzleteil davon ist das totalrevidierte Energiegesetz. Doch was Ständerat Gian-Reto Plattner 1997 in der Eintretensdebatte zum «alten» Energiegesetz sagte, hat noch immer seine Gültigkeit: «Wenn Sie sich überlegen, welche zentralen Fragen der Energiepolitik in den nächsten Jahren anstehen, dann sehen Sie sofort, dass das Energiegesetz nicht das letzte Gesetz in diesem Bereich sein kann.» Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt, in dem die Dynamik der Energietechnologien und der Märkte so gross wie nie zuvor sein wird. So stellt sich auch weiterhin die Frage der richtigen Balance zwischen Markt und Regulation und zu hoffen bleibt, dass sich die Vertreter der beiden Pole nicht wieder gegenseitig blockieren.
Marianne Zünd, Leiterin Medien und Politik BFE
Bild: KEYSTONE
 KEYSTONE
KEYSTONE

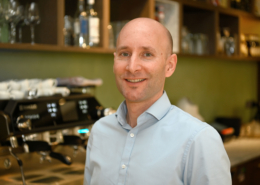 Martin BichselGastrounternehmen setzt Geräte effizienter ein
Martin BichselGastrounternehmen setzt Geräte effizienter ein  Westenergie AGWenn Strom ohne Widerstand fliesst
Westenergie AGWenn Strom ohne Widerstand fliesst  «Laden zuhause ist zentral für die Entwicklung der Elektromobilität»
«Laden zuhause ist zentral für die Entwicklung der Elektromobilität»  ©SG-DETECUn chauffeur au courant
©SG-DETECUn chauffeur au courant 
 Shutterstock
Shutterstock Nagra
Nagra
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!